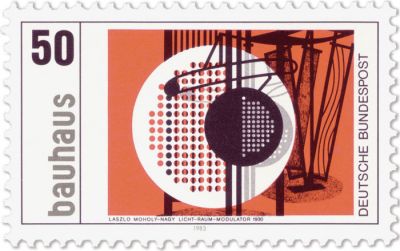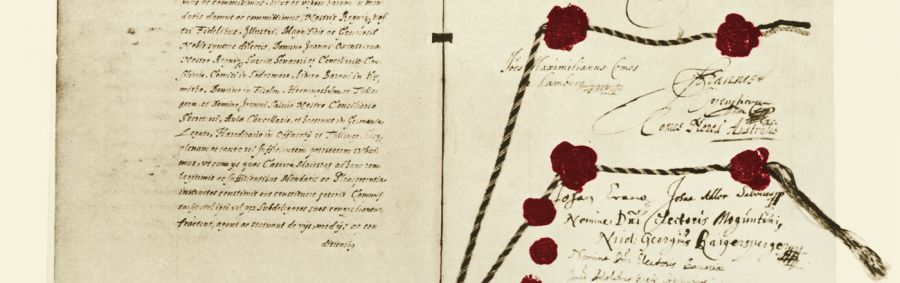„Jede Zeichnung ein Blitzkrieg“

Foto: IMAGO / Hans Lucas
Heute ist Tomi Ungerer gestorben. Jüngster Spross eines Straßburger Uhrmachers und Fabrikanten für Turmuhren, welcher darüber hinaus für die astronomische Uhr des Münsters zuständig war. Wenn ein Leben mit einer solchen Parabel beginnt, muss was draus werden. Tomi Ungerer wurde einer der berühmtesten Zeichner der westlichen Welt. Ein Schriftsteller, Illustrator und Werbegrafiker, der mir mit seinem Gesamtwerk immer hundertprozentig sympathisch war, ohne dass mir alles gefallen hätte. Ein Charakter, der mich in seiner politischen und (a)moralischen Ausrichtung überzeugt, was ich aber auf die Schnelle nicht so leicht erklären kann. Ein wirklich grandioser Spiegel-Artikel nimmt mir die Arbeit ab. Hier ist alles geschmeidig aneinander gereiht, was mir selbst spontan nicht einfällt – und bei der Headline hätte ich zumindest gezögert …
mehr …