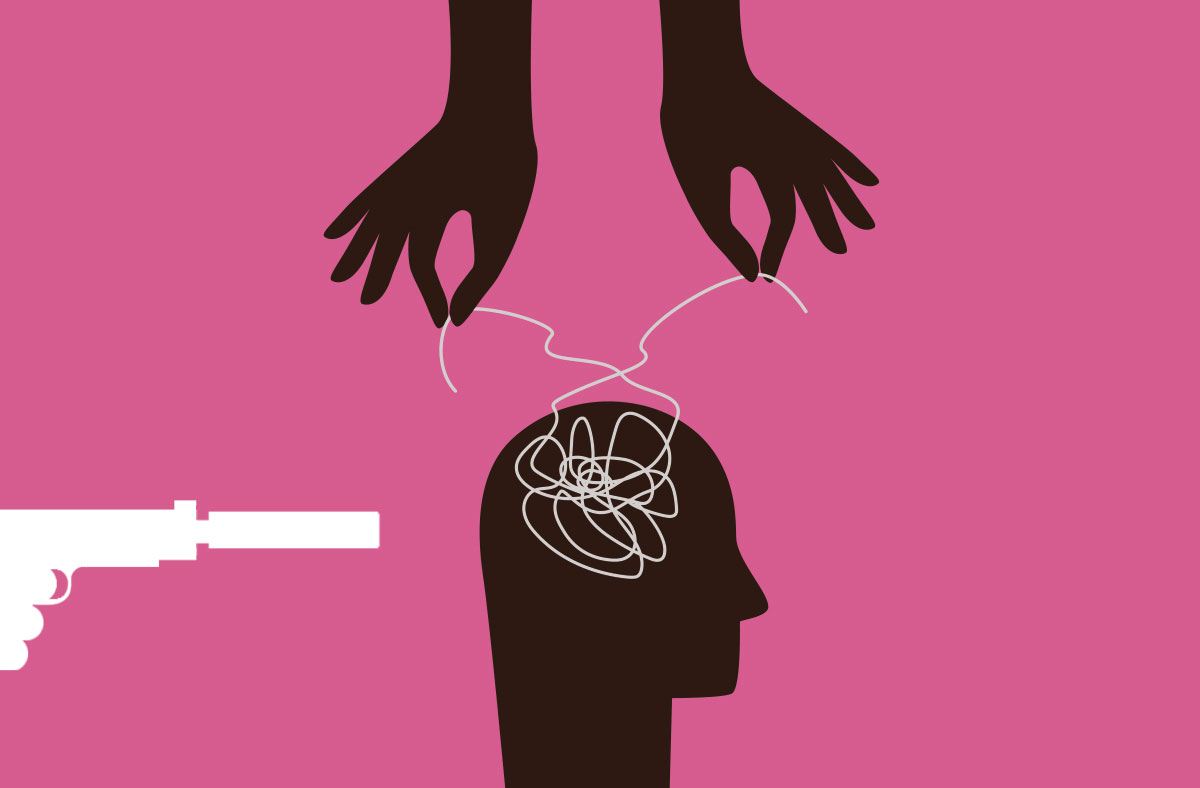Stolz und Vorurteil (I)

Foto: AdobeStock
Mein Blog scheint mitunter etwas widersprüchlich, was wohl in der lebhaften Natur der schönen Künste liegt. Einerseits empfinde ich diese bunte Parallelwelt als großes Glück, andererseits geht mir der selbstverliebte Kulturbetrieb dann doch wieder auf den Geist und ich geniere mich, dass ich nichts „Vernünftiges“ mache. Ein Künstlerkollege geht sogar so weit, dass er sein Metier bei neuen gesellschaftlichen Kontakten erst mal verleugnet, und obwohl er einen löblichen Abschluss der Münchner Kunstakademie vorzuweisen hat, antwortet er auf die Frage nach seinem Beruf sehr vage. Zuweilen behauptet er sogar, er arbeite bei Lidl. Und sei es nur, damit ihm kein leutseliger Dilettant die Belegfotos des eigenen Gepinsels stolz auf dem Smartphone vorführt. Also noch ein Dilemma, man ist gleichzeitig verschämt und arrogant.
Ein Designer braucht sich dagegen nicht wie ein brotloser Künstler zu fühlen, muss sich nur gelegentlich vielleicht für seinen vermeintlich labilen Charakter rechtfertigen. Soll heißen, man traut uns durchaus einen gewissen Geschäftssinn zu, hat aber moralische Bedenken, wenn es um Werbung geht, sofern man nicht gerade Greenpeace oder Amnesty International auf der Kundenliste hat. Der Kreis derer, die Werbung eher abschätzig beurteilen, ist immer noch erstaunlich groß. Was wiederum recht absurd ist, weil der Kreis derer, die in extremer Abhängigkeit von öffentlicher Meinung und eben Werbekampagnen, Mode- und Lifestyle-Propaganda leben und sich per Instagram und Co. für die Zivilgesellschaft akkreditieren, bei gefühlt 80 Prozent liegt. Um „in“ zu sein, sucht jeder den engen Kontakt zum Mainstream und der ist da, wo die Werbefrequenz am höchsten ausschlägt.
Der obskure Verdacht der Manipulation
Schon länger her, da gestand mir ein Projektverantwortlicher in Sommerfestlaune, dass er auch Grafiker hätte werden wollen und vom Talent her auch hätte werden können – aber: die Sache mit der Manipulation von Menschen sei ihm zuwider. Das verbiete ihm dann doch sein Gewissen. Ich hätte gerne gleich etwas dagegen sagen können und auch wollen, allein mein Gegenüber redete wie auf Knopfdruck los und hatte sich alsbald in sein methodisches Palaver hineinbegeistert, kurz: Ich kam nicht zu Wort und hatte just in dieser Situation das Gefühl, im eigenen Trachten und Sinnen spürbar bedrängt und quasi manipuliert zu werden.
Und genau das wäre schon mein erster Whataboutism gewesen. Stattdessen reagierte ich ironisch, mein drittes Bier in der Hand und heiter befremdet darüber, dass man offensichtlich mein Büro für diese verachtenswerte Manipulationsarbeit engagiert hätte. Ob wir denn so etwas wie Auftragskiller für sein Institut seien? Das fand der studierte Sprachwissenschaftler etwas übertrieben, aber in der Sache nicht ohne satirischen Witz.
Illu-Vorlage: shutterstock
„Manipulieren, aber richtig“ – Life-Coaching und Doppelmoral
Als ich als Jugendlicher das Buch des Österreichers Josef Kirschner mit dem oben zitierten, für mich damals unsittlich klingenden Titel zum ersten Mal entdeckte, war ich misstrauisch. Der Journalist schrieb nicht nur die Konzepte für die progressive TV-Show „Wünsch dir was“, sondern hatte sich schon mit einem weiteren Buch namens „Die Kunst, ein Egoist zu sein“ berühmt gemacht. Das war in den Siebzigern sehr provokant, schließlich gab man sich als kritischer Bürger gerne auch selbstlos und moralisch. Was gleichzeitig irritierte, denn gerade in dieser Zeit wurde der Modebegriff der Selbstverwirklichung inflationär gebraucht.
Wenn man also einerseits die Nase rümpfte über Bücher mit „unanständigen“ Vokabeln, andererseits darin aber den praktischen Rat für eine durchsetzungsstarke Lebensführung suchte, wurde die ganze Heuchelei sichtbar. Man echauffiert sich schnell und arbeitet dabei nur mit Schlüsselreizen, diffusen Meinungsbildern und nicht mit Tatsachen. Faktisch gab es in beiden Büchern ein paar sehr plausible Erklärungen für die Dynamik des menschlichen Miteinanders. Verwerflich oder gar hinterhältig war daran überhaupt nichts. Im Prinzip ging es schlicht darum, dass man für sich und seine Mitmenschen ein paar Argumente fürs eigene Denken und Handeln bekam. Man hat so seine Vorstellungen und möchte sich einbringen. Wer stellt sich dabei schon extra dämlich an? Jede Form der Werbung – im Privatleben wie im Business – beruht auf einer geschickten Selbstdarstellung.
All diese Rechtfertigungsarien ziehen sich wie ein roter Faden durch meinen Blog – und das hat natürlich seinen Grund. Es ist nun einmal so, dass man sich ständig erklären muss, so will es die Gesellschaft. Diejenigen, die sich vordrängeln, über andere Leute lästern und deren Arbeit zunichte machen, setzen darauf, dass man klein beigibt. Es ist leicht, eine gute Sache mit einer einzigen blöden Bemerkung zu diskreditieren – und dann war alle Mühe umsonst. Wer sich dann beleidigt zurückzieht, macht es Dumpfbacken à la Trump leicht. Fazit, in Abwandlung des Brecht-Zitats: Wer sich nicht erklärt, lebt verkehrt!
Mein persönliches Moral-Paradoxon
Der Unsinn beginnt damit, dass man Dinge kritisiert, die eigentlich gut sind. Ich für meinen Teil möchte mir keinen Sport daraus machen, bei meinen Mitmenschen radikal und somit kleinlich nach Fehlern zu suchen. Wer sich fanatisch selbst kasteien möchte, mag das tun. Aber solches von anderen zu verlangen, steht uns nicht zu. Gegenseitiges Beäugen und Bekritteln halte ich für eine Pest im gesellschaftlichen Leben. Wollen wir uns stattdessen nicht lieber gegen das rechte Pack solidarisieren und ihm eins mitgeben? In dem Fall gerne ohne Rücksicht auf Anstand und Sitte, aber dafür untereinander etwas konzilianter?
Zum Beispiel könnten wir aufhören, uns gegenseitig die Worte im Mund herumzudrehen und mit den Augen zu rollen, wenn jemand einen Begriff verwendet, der seit letzter Woche in den Charts politischer Unkorrektheiten steht. Seit langer Zeit beschleicht mich das dumpfe Gefühl, dass wir Renaissance-Menschen an unserer billigen Eitelkeit zu scheitern drohen. In unserer Selbstgefälligkeit und humanistischen Gesinnung sind wir so weit entrückt, dass wir auf der ordnungsgemäß linken Spur nicht bemerken, wie wir von Dunkelmännern rechts überholt werden.
Stolz und Vorurteil (i, II und III)
Teil 1 Die Eitelkeit des Renaissance-Menschen
Teil 2 Über den stoischen Umgang mit Neid und Missgunst
Teil 3 Die Dekadenz der westlichen Welt